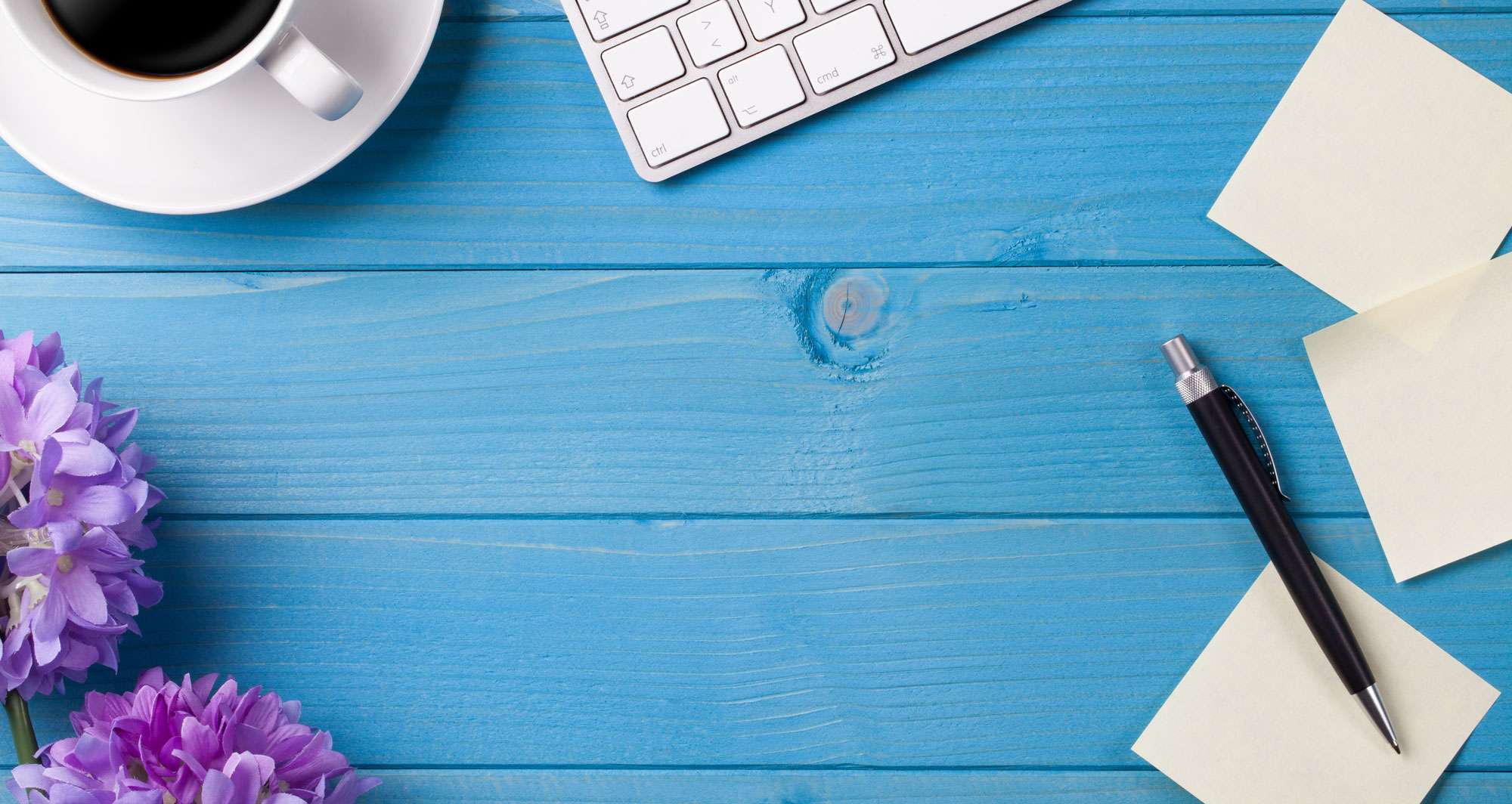Das Dresdner Modell ist ein Qualitätsentwicklungsverfahren für den U3 Bereich und macht kindliches Wohlbefinden zum Ausgangspunkt für pädagogisches Handeln. Im Mittelpunkt steht eine videogestützte Beobachtungsmethode, mit der die Pädagog_innen das Wohlbefinden von Kindern anhand sogenannter „Feinzeichen“ einschätzen können. Der Qualitätsentwicklungsprozess ist im Dresdner Modell diskursiv angelegt, daher stellt das Verfahren neben der Beobachtung kindlichen Wohlbefindens gezielt Methoden des fachlichen Austauschs zur Verfügung. Inhalte der Tagesveranstaltung: - Einführung in das Dresdner Modell - Die Fokusse der Beobachtung im Dresdner Modell - Grundgedanken zum kindlichen Wohlbefinden und Feinzeichen - praktische Arbeit mit einem Fremdvideo Informationen unter: https://www.dresdner-modell-wohlbefinden.de/dresdner-modell.html Organisatorisches: Verpflegung und Getränke sind selbst mitzubringen. Ein kostenpflichtiger Kaffeeautomat ist verfügbar. Fußläufig können ein Netto und eine Pizzeria erreicht werden. Bitte achten Sie auf die Öffnungszeiten. Zielgruppe: Pädagogische Fachkräfte von Krippen und Kindertagespflegepersonen
Die Fortbildung lädt pädagogische Fachkräfte ein, den Blick auf die besonderen Momente im Tagesablauf zu richten. Ob beim Ankommen, beim Wechsel zwischen Spiel, Essen und Ruhe – Übergänge prägen das Wohlbefinden von Kindern und sind entscheidend für eine gelingende Entwicklung. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich die individuellen Bedürfnisse der Kinder, Gruppengeschehen und Tagesstrukturen harmonischer miteinander verbinden lassen. Ebenso werden innere Antreiber pädagogischer Fachkräfte thematisiert, die dazu verleiten können, Effektivität und Schnelligkeit über die Beteiligung und die Selbstlernprozesse der Kinder zu stellen. Die Teilnehmenden erwartet eine lebendige Mischung aus fachlichen Impulsen, Reflexion und Fallarbeit in Kleingruppen und methodischen Interventionen. Sie gewinnen neue Perspektiven und Ideen für die Gestaltung von Übergängen, mit denen Kinder gestärkt wachsen können, Teams entlastet werden und der Kita-Alltag leichter und erfüllter gelingen kann. Organisatorisches: Verpflegung und Getränke sind selbst mitzubringen. Ein kostenpflichtiger Kaffeeautomat ist verfügbar. Zielgruppe: Pädagogische Fachkräfte in der Arbeit mit Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren.
Wie können Sie Dienstberatungen lebendiger, konstruktiv und effizienter durchführen? Wie lassen sich Elternabende so gestalten, dass sie zu einem echten Austausch und zu gelingender Zusammenarbeit führen? Mit dieser Veranstaltung werden Sie gemeinsame praxisnahe Methoden kennenlernen, ausprobieren und reflektieren. Mit einem prall gefüllten "Methodenkoffer" erarbeiten wir gemeinsam, wie Sie Ihre Sitzungen und Elternabende abwechslungsreicher und dialogorientierter gestalten können. Sie erhalten konkrete "Werkzeuge", die sich direkt in Ihren pädagogischen Alltag übertragen lassen und sowohl die Zusammenarbeit im Team als auch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Ihren Eltern stärken. Zielgruppe: Leitungen und pädagogische Fachkräfte von Krippen, Kindergärten, Horten und Kindertagespflegepersonen